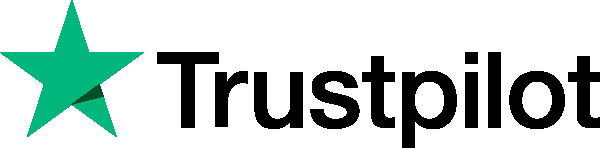Wichtige Verfahrensregeln
Die Zivilprozessordnung gilt in der gesamten Schweiz. Sie enthält detaillierte Regeln für alle Verfahren, insbesondere für Verfahren im Familienrecht.
Familienrechtliche Verfahren werden nach dem «vereinfachten Verfahren» (Art. 243 bis 247 ZPO) durchgeführt, das weniger formalistisch und schneller sein soll als das ordentliche Verfahren, vorbehaltlich einstweiliger Massnahmen, die dem summarischen Verfahren unterliegen (Art. 248 ZPO).
Um die verschiedenen Aspekte des vereinfachten Verfahrens zu vertiefen, siehe den (kostenpflichtigen) Artikel von François Bonnet und Yan Wojcik, veröffentlicht in FAMPRA S. 872 ff: «La procédure simplifiée en divorce contentieux sous l’empire du CPC révisé» (2024).
Generell:
Treu und Glauben
Jede Partei hat nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 52 ZPO).
Rechtliches Gehör
Vor einer Entscheidung hat jeder Partei Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 53 ZPO).
Dies ist ein grundlegendes verfassungsmässiges Prinzip (Art. 29 Abs. 2 BV).
Das bedeutet nicht unbedingt, dass sich jeder mündlich ausdrücken soll. Der Anspruch auf rechtliches Gehör kann schriftlich ausgeübt werden.
Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst insbesondere:
- Das Recht für die Partei, relevante Beweise zu den Fakten vorzulegen, die die zu treffende Entscheidung beeinflussen könnten
- Die Möglichkeit, auf relevante Beweisangebote zu reagieren
- Die Teilnahme an der Verwaltung wesentlicher Beweise oder zumindest die Möglichkeit, sich zu deren Ergebnissen zu äussern, es sei denn, die zu beweisende Tatsache ist irrelevant oder das Beweismittel erscheint offensichtlich ungeeignet, die behauptete Tatsache zu beweisen, und sich dazu zu äussern (5A_79/2023 E. 3.3.1).
In sehr dringenden Fällen (insbesondere bei Gewalt) kann das Gericht eine erste Entscheidung ohne rechtliches Gehör der anderen Partei treffen (superprovisorische Massnahme, Art. 265 ZPO), muss jedoch die Parteien schnellstmöglich einberufen, damit sie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör geltend machen können, und eine ordentliche vorsorgliche Massnahme bestätigen oder nicht, die in der Eile getroffen wurde.
Recht auf Beweis
Das Recht, seine Behauptungen zu beweisen, ergibt sich aus dem verfassungsmässigen Recht, Anspruch auf rechtliches Gehör zu haben (Art. 29 Abs. 2 BV), aus Art. 8 ZGB und aus Art. 152 ZPO. Jede Partei hat das Recht, eine relevante bestrittene Tatsache zu beweisen, die angemessenen Beweismittel zu verwalten, sofern sie ordnungsgemäss und rechtzeitig vorgeschlagen wurden. Das Gericht kann jedoch auf ein Verlangen, eine bestimmte Tatsache zu beweisen, verzichten, wenn es der Ansicht ist, dass es bereits genügend Informationen hat, um seine Entscheidung zu treffen, und dass der geforderte Beweis die bereits aufgrund anderer Beweise gewonnene Überzeugung nicht ändern würde (Antizipierte Beweiswürdigung; 5A_79/2023 E. 3.2.2).
Beweis und Beweiswürdigung
Das Bundesgericht gesteht den kantonalen Gerichten ein «weites Ermessen» zu.
Ermessen bedeutet aber nicht nach Belieben zu entscheiden. Das Bundesgericht hebt den kantonalen Entscheid nur dann auf, wenn er in seiner Begründung und seinem Ergebnis willkürlich ist oder wenn das kantonale Gericht andere als die anzuwendenden Kriterien zugrunde gelegt hat (5A_70/2024 E. 2.3; 5A_727/2023 E. 7.2.1 und 7.2.2 und 9.1.1.2 und 9.4 und 10.1 und 10.2).
Der Beweis kann durch die Aussagen der Parteien, die Anhörung von Zeugen, Gutachten, Urkunden (Grundbuchauszug, Familienausweis usw.) oder Unterlagen (Vertrag, Schriftstück, Arztzeugnis, ein Dokument wie ein Bericht eines Detektivs) erbracht werden.
Zur Würdigung eines von einer nicht spezialisierten Person abgegebenen ärztlichen Gutachtens vgl. BGE 151 V 258 (der Entscheid erging zwar im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens, dürfte nach unserer Auffassung jedoch auch im Zivilverfahren Anwendung finden).
Ein provisorischer und summarischer Bericht bzw. eine entsprechende Einschätzung, die von einer spezialisierten Person erstellt wurde, ist als Gutachten zu würdigen, sofern die Durchführung dieses Berichts bzw. dieser Einschätzung derjenigen eines Gutachtens entspricht (BGE 150 IV 462 E. 3.3–3.8, ergangen im Strafverfahren, nach unserer Auffassung jedoch ebenfalls auf das Zivilverfahren übertragbar).
Einige Beweise können nicht erbracht werden, da sie rechtswidrig sind. Dazu gehören insbesondere Audio- oder Videoaufnahmen, E-Mails, die ohne Zugriff auf das E-Mailbox erhalten wurden. Das Gericht ist immer vollständig frei in der Würdigung des Beweiswerts (ausser, wenn er aus einem offiziellen Titel, einer notariellen Urkunde oder offenkundigen Tatsachen resultiert). Zu der zweifelhaften Gültigkeit eines Arztzeugnisses siehe 5A_79/2023 E. 3.3.3.
Um über das Schicksal der Kinder (elterliche Sorge, Besuchsrecht, Obhut, persönliche Beziehungen) zu entscheiden, kann das Gericht ein Gutachten anordnen. Grundsätzlich ist es nicht an das Gutachten gebunden, sondern muss dieses unter Berücksichtigung aller anderen erhobenen Beweise beurteilen. Es darf jedoch nicht ohne ernsthaften Grund davon abweichen und muss seine Entscheidung diesbezüglich begründen (5A_192/2024).
Ob ein Gutachten überzeugend ist oder nicht, ist eine Frage der Beweiswürdigung. Die kantonalen Gerichte haben einen weiten Ermessensspielraum (Art. 157 ZPO) und das Bundesgericht überprüft die freie Beweiswürdigung des kantonalen Richters nur unter dem eingeschränkten Gesichtspunkt der Willkür (Art. 9 BV).
Ein Entscheid ist nicht allein deshalb willkürlich, weil er fragwürdig oder gar kritisierbar erscheint; er muss vielmehr offensichtlich unhaltbar sein, und zwar nicht nur in seiner Begründung, sondern auch in seinem Ergebnis (6B_1055/2023 E. 2.1.1).
Willkür liegt vor, wenn die Behörde ohne ernsthaften Grund ein Beweismittel nicht berücksichtigt, das geeignet ist, den Entscheid zu ändern, wenn sie sich offensichtlich über dessen Sinn und Tragweite täuscht oder wenn sie aufgrund der erhobenen Beweise zu unhaltbaren Feststellungen gelangt (5A_878/2024 E. 2.3 und 3.2; 5A_192/2024 E. 2.2).
Wenn das kantonale Gericht ein Gutachten als schlüssig erachtet und sich dessen Ergebnis zu eigen macht, wird die Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung vom Bundesgericht nur dann zugelassen, wenn der Expert die gestellten Fragen nicht beantwortet hat, wenn seine Schlussfolgerungen widersprüchlich sind oder wenn das Gutachten auf andere Weise mit derart offensichtlichen und erkennbaren Mängeln behaftet ist, dass es auch ohne Fachkenntnisse einfach nicht möglich war, sie zu ignorieren. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts zu prüfen, ob alle Aussagen des Experts frei von Willkür sind; seine Aufgabe beschränkt sich darauf, zu untersuchen, ob die Vorinstanz ohne Willkür mit den Schlussfolgerungen des Gutachtens einverstanden sein konnte (5A_809/2023 E. 3.1).
Ebenfalls in den Bereich der Beweiswürdigung fällt die Frage, ob ein Gutachten lückenhaft, unklar oder ungenügend begründet ist im Sinne von Art. 188 Abs. 2 ZPO.
Es ist allein Sache des Richters und nicht des Experts, die rechtlichen Konsequenzen aus einem Gutachten zu ziehen, insbesondere wenn es um das Schicksal der Kinder geht, d. h. insbesondere zu bestimmen, ob die Voraussetzungen für die Zuweisung der Obhut an den einen oder anderen Elternteil erfüllt sind (5A_192/2024 E. 3.1.1).
Mitwirkungspflicht
Die Parteien sind zur Mitkirkung mit dem Gericht verpflichtet, insbesondere bei der Feststellung der Tatsachen. Wenn eine Partei die Mitwirkung verweigert, wird das Gericht dies bei der Bewertung der Beweise berücksichtigen und tendenziell dazu neigen, dass die Aussagen der mitwirkenden Partei korrekt sind, während die Aussagen der nicht mitwirkenden Partei dies nicht sind. Das Gericht hat dabei einen grossen Ermessensspielraum.
Hier werden die Begriffe des Urteils 5A_978/2020 E. 7.5.2, übernommen: Art. 170 ZGB verpflichtet den Ehegatten, seinen Partner über seine Einkommen, Vermögenswerte und Schulden zu informieren, und das Gericht kann ihn sogar dazu verpflichten. Die Rechtsprechung präzisiert, dass das Verhalten des Ehegatten, der die ihm durch diese Bestimmung auferlegte Pflicht verletzt, indem er sich weigert, mit dem Gericht mitzuwirken, dazu führen kann (und nicht muss), dass die Justizbehörde von der vollständigen oder teilweisen Unwahrheit seiner Behauptungen überzeugt wird (5A_79/2023 E. 5.4; BGE 118 II 27 E. 3; 5A_155/2015 E. 4.2).
Darüber hinaus sind die Parteien gemäss Art. 160 Abs. 1 ZPO verpflichtet, bei der Verwaltung der Beweise zusammenzuwirken. Wenn eine Partei dies ohne triftigen Grund verweigert, sieht Art. 164 ZPO vor, dass das Gericht dies bei der Beweiswürdigung berücksichtigt. Diese Bestimmung gibt jedoch keine Anweisungen für die Konsequenzen, die das Gericht aus der Verweigerung der Mitwirkung bei der Beweiswürdigung ziehen muss. Es ist insbesondere nicht vorgeschrieben, dass das Gericht automatisch zu der Wahrheit der von der gegnerischen Partei vorgelegten Tatsachen kommen muss; vielmehr soll die ungerechtfertigte Verweigerung der Mitwirkung als ein Element unter vielen in die freie Beweiswürdigung einbezogen werden (Art. 157 ZPO; BGE 140 III 264 E. 2.3; 5A_622/2020 E. 3.2.4; 5A_689/2020 E. 4.2).
Verhandlungsgrundsatz / Dispositionsgrundsatz und Untersuchungsgrundsatz / Offizialgrundsatz
Gemäss Art. 55 ZPO muss jede Partei die Tatsachen nachweisen, auf die sie sich stützt; das Gericht sucht oder beweist sie nicht selbst. Dies ist der Verhandlungsgrundsatz (manchmal als «Dispositionsgrundsatz» bezeichnet, vgl. Art. 58 ZPO; 5A_582/2020 E. 6.2.2).
Es gilt für alle Ansprüche zwischen Erwachsenen (z. B. Unterhaltsbeiträge zwischen Erwachsenen, Auflösung des Güterstandes, insbesondere Art. 277 ZPO).
In Scheidungen / Trennungen im gegenseitigen Einvernehmen wird das Gericht daher nicht eingreifen und Vereinbarungen zur Auflösung des Güterstandes oder zu Unterhaltsbeiträgen (oder deren Fehlen) zwischen Erwachsenen ohne Diskussion akzeptieren, ausser wenn die Vereinbarung ist «offensichtlich unangemessen» (Art. 279 ZPO).
In einigen Fällen ist das Gericht verpflichtet, die Fakten selbst festzustellen (Art. 272 ZPO; Art. 296 ZPO). Dies ist dann die Untersuchungsgrundsatz (manchmal als «Offizialprinzip oder Offizialgrundsatz» bezeichnet, vgl. Art. 58 ZPO).
Dies betrifft insbesondere alle Aspekte, die die Kinder betreffen (Sorgerecht, Obhut, Besuchsrecht, Unterhaltsbeiträge) und die Aufteilung oder Nichtaufteilung der während der Ehe angesammelten beruflichen Vorsorge.
In diesen Fällen ist es das Gericht selbst, das die notwendigen Fakten suchen muss, um eine Entscheidung zu ermöglichen. Die Parteien müssen mitwirken, aber das Gericht bleibt immer vollständig frei, über diese Themen zu entscheiden, indem es selbst die für seine Entscheidung notwendigen Fakten sucht, ohne an die Schlussfolgerungen oder Parteianträge gebunden zu sein (Art. 296 Abs. 3 ZPO; 5A_274/2023 E. 4.1.2 und 5.2).
Die Regel gilt auch vor Berufungsgerichten (BGE 144 III 349) und jede Partei kann in der Berufung neue Tatsachen vorbringen, wenn der Untersuchungsgrundsatz gilt (5A_654/2022 E. 3.1).
Zur Vertiefung siehe:
- den (konstenpflichtigen) Artikel von Jean-Michel Ludin: «Prozessmaximen im Unterhaltsrecht − Grundsätze und ausgewählte Fallstricke» (2025)
- den (kostenpflichtigen) Artikel von Philipp Maier «Das Gericht wird es nicht mehr richten» (2024), veröffentlicht in FAMPRA 2024 S. 905 ff und die klugen Ratschläge des Autors (Richter am Bezirksgericht Uster ZH) für Rechtsanwälte, insbesondere zur Genauigkeit von Behauptungen (und den Folgen ungenauer oder unzureichender Behauptungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Fähigkeit, für den eigenen Unterhalt aufzukommen) und zur dynamischen Berechnung des Unterhalts.
Nicht öffentliche Verhandlung
Im Familienrecht sind Verhandlungen nicht öffentlich gemäss Art. 54 Abs. 4 ZPO statt (ohne Anwesenheit der Öffentlichkeit, nur die Parteien und ihre eventuellen Anwälte sind vor dem Gericht anwesend).